Sommersonnenwende – heute ist der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres 2024
Nordoberpfalz. Astronomen haben für heute den längsten Tag und die kürzeste Nacht errechnet. Am kommenden Wochenende werden die traditionellen Sonnwendfeuer zu sehen sein. Was steckt hinter diesem uralten Brauch? OberpfalzECHO geht auf Spurensuche.

Es gab Zeiten, in denen die Wissenschaft noch nicht so fortgeschritten war wie heute und Phänomene und markante Ereignisse im Jahreslauf mystisch erklärt wurden. Die Sommersonnenwende am 24. Juni mit den dazugehörigen Bräuchen – wie dem Johannisfeuer -gehört mit Sicherheit dazu. Doch die eigentliche Sonnenwende fällt in diesem Jahr auf den 20. Juni. OberpfalzECHO hat nachgeforscht.
Astronomen berechnen die Sonnenwende 2024 für den 20. Juni
Während das christliche Brauchtum seit Jahrhunderten den 24. Juni, dem Festtag von Johannes dem Täufer, als Sonnenwende benennt, sind Astronomen anderer Meinung. Der Zeitpunkt variiert nämlich jedes Jahr, weil die Jahreslänge und die Erdumlaufbahn nicht synchron sind. Deshalb gibt es auch jedes Jahr einen Schalttag im Februar. Für das Jahr 2024 haben die Astronomen den Höhepunkt der Jahresbahn der Sonne exakt auf 22.51 Uhr am heutigen 20. Juni errechnet.
Was steckt hinter den Bräuchen zur Sommersonnenwende?
Der Brauch des Sonnwendfeuers hat seinen Ursprung in vorchristlichen Traditionen und Bräuchen. Er ist eng mit der Sommersonnenwende verbunden, dem Tag mit der längsten Tageslichtdauer im Jahr. Die Sonnwendfeuer gehen auf heidnische Feuer- und Lichtkulte zurück, die die Sonne und ihre Bedeutung für das Leben feierten. In der germanischen Mythologie symbolisierten die Feuer den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Manche Theorien besagen, dass die Feuer ursprünglich Fruchtbarkeitsriten oder Reinigungszeremonien dienten.
Im Christentum wurde das heidnische Brauchtum auf das Fest des Hl. Johannes des Täufers – nach dem julianischen Kalender am 24. Juni – übertragen. Nachdem die Kirche Jahrhunderte lang vergeblich versucht hatte, die heidnischen Sonnwendfeiern zu unterdrücken, musste sie erfolglos aufgeben und letztendlich diese Lebensfreude in die christliche Tradition integrieren.
Die Johannisfeuer symbolisierten fortan Christus als „Licht der Welt“ und Johannes den Täufer als „Vorläufer des Lichts“. Das Johannisfeuer deutete nun Christus als die „wahre Sonne“. Viele heidnische Bräuche wie Kräutersegnungen und Fruchtbarkeitssymbole wurden in die Johannistradition übernommen.
Kräuter und Pflanzen werden gesegnet
Der Glaube, dass Kräuter an Johanni besonders heilkräftig seien, stammt aus heidnischen Traditionen. Pflanzen wie das Johanniskraut, die Johannisbeere und der nach Johanni benannte Johannistrieb von Bäumen gehen auf den vorchristlichen Brauch zurück, Pflanzen nach der Sommersonnenwende zu benennen.
Fruchtbarkeits- und Reinigungsriten
Manche Theorien besagen, dass die Sonnenwendfeuer ursprünglich Fruchtbarkeitsriten oder Reinigungszeremonien dienten. Dazu gehörten Bräuche wie das nächtliche Johannisbad in Flüssen und Seen zur spirituellen Reinigung.
Auch in der Oberpfalz springen heute noch Paare über die Flammen des Johannisfeuers, um Mut zu beweisen und im Glauben, ihre Fruchtbarkeit zu steigern. Johanniskränze aus bestimmten Kräutern und Blumen wie Johanniskraut, Rosen, Lilien etc. sollten unter dem Kopfkissen die Fruchtbarkeit und das Liebesglück fördern.
Brauchtum und Aberglaube
Zahlreiche Bauernregeln, Sprichwörter und Wettervorhersagen rund um den Johannistag gehen auf vorchristliche Traditionen zurück. Dazu zählen Ernteregeln, Beobachtungen von Tieren und Pflanzen sowie Aberglaube wie die Bedeutung des Johannistaus, also dem Tau, der in der Nacht zum Johannistag fällt. Im Volksglauben wurde diesem Tau eine besondere Heil- und Segenskraft zugeschrieben. Deshalb badete man in diesem Tau oder sammelte ihn in Gefäßen.
Johannistag auch als ‚Spargelsilvester‘ bekannt
Der Johannistag am 24. Juni wird auch als „Spargelsilvester“ bezeichnet, weil an diesem Tag traditionell die Spargel- und Rhabarbersaison endet. Die Gründe dafür sind: Spargelpflanzen benötigen nach der anstrengenden Erntezeit eine Ruhepause, um für die nächste Saison wieder genügend Kraft zu sammeln. Wird Spargel nach dem Johannistag weiter gestochen, schwächt das die Pflanze zu sehr. Rhabarberblätter enthalten ab Ende Juni einen zu hohen Oxalsäuregehalt, weshalb man die Ernte dann einstellt, damit sich die Pflanze regenerieren kann.
Es gilt die alte Bauernregel: „Kirschen rot, Spargel tot“ – wenn die Kirschen reif sind, sollte man mit der Spargelernte aufhören.
Bauernregeln für den Johannistag
Der 24. Juni gilt im Bauernkalender als sogenannter Lostag, also ein markanter Tag, der einen Wendepunkt im Jahreslauf markiert. Deshalb gibt es für den Johannistag besonders viele Bauernregeln. Eine Auswahl:
- Vor dem Johannistag, keine Gerste man loben mag.
- Regen am Johannistag, nasse Ernt‘ man erwarten mag.
- Bringt Johanni Sommerhitze, ist es Korn und Runkeln nütze
- Der Kuckuck kündet teure Zeit, wenn er nach Johanni schreit.
- Wenn die Johanniswürmer glänzen, darfst Du richten Deine Sensen.
- Wenn kalt und nass Johannis war, verdirbt er meist das ganze Jahr.
- Vor Johanni Regen und Wind, ist’s für die Ernte nicht gut gesinnt.


 Jobbörse
Jobbörse  Events
Events  Mediathek
Mediathek 
 Suche
Suche  Meine News
Meine News 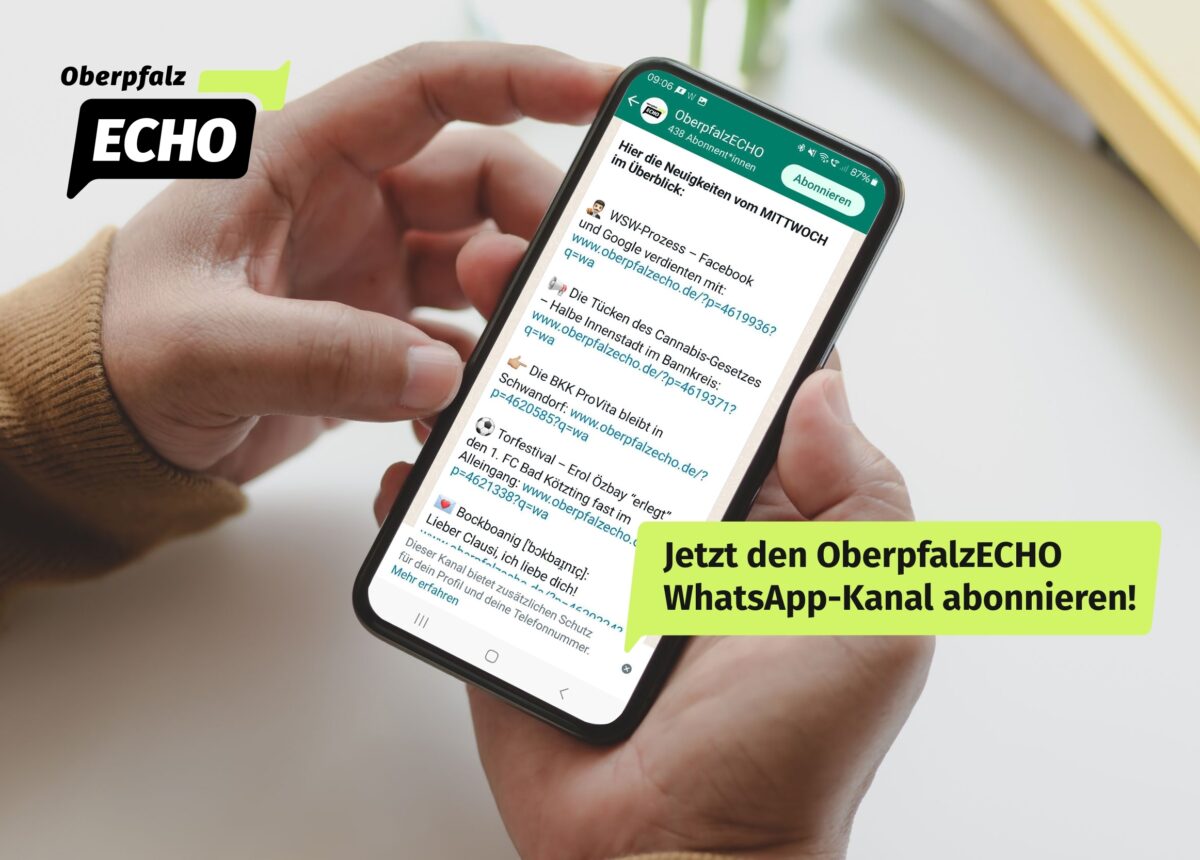



* Diese Felder sind erforderlich.