Achtung: Heute beginnen die „Eisheiligen“
Weiden. Einer der wichtigsten Termine im Gartenjahr sind die sogenannten Eisheiligen. OberpfalzECHO klärt auf, was hinter diesem Begriff steckt.

Es gibt eine eiserne Regel unter den Hobbygärtnern: Erst wenn die „Eisheiligen“ vorbei sind, dann ist man vor Nachtfrösten einigermaßen sicher. Dann erst sollte man die vorgezogenen Tomaten-, Gurken- und Paprika-Pflanzen ins Freiland pflanzen. Was ist dran, an den „Eisheiligen“? OberpfalzECHO macht sich auf Spurensuche.
Was Oma noch wusste
Die „Eisheiligen“ dienen Gärtnern als klimatischer Wendepunkt für die letzten Fröste des vergangenen Winters, die im Mai stattfinden. Man sagt, dass ab Mitte Mai die Sonne mit hoher Wahrscheinlichkeit so viel Wärmepotential hat, dass auch wärmeliebende Kulturen ins Beet umziehen können. Zur Not kann man kalten Nächten mit Vlies, Kerzen im Gewächshaus oder einem Folientunnel beikommen.
Unsere Vorfahren lebten vielfach von der Landwirtschaft. Um verschiedene Ereignisse während der Vegetationsperiode zu benennen, entwickelte der Volksmund die sogenannten „Bauernregeln“. Diesen Regeln liegen persönliche Erfahrungen zugrunde, die heutigen wissenschaftlichen Standards nicht mehr genügen.
„Eisheilige“ sind wissenschaftlich nicht belegbar
Die „Eisheiligen“ gehen wahrscheinlich eher auf die subjektive Beobachtung zurück, dass nach ein paar wärmeren Tagen im April, nochmals Nachtfrost auftritt. Unumstritten ist, dass eine nordöstliche Kaltströmung um diese Jahreszeit üblich ist.
Wetterexperten wie Jörg Kachelmann sind sich sicher, dass die Theorie von den „Eisheiligen“ nicht zu halten ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler mit ihren Statistiken recht. Trotzdem ist es kein Fehler, bis Mitte Mai abzuwarten, wenn man empfindliche Pflänzchen ins Freiland ausbringen will.
Wann sind die „Eisheiligen“?
Die „Eisheiligen“ beginnen in Bayern am 12. Mai mit dem Fest des Hl. Pankratius.
Nördlich von Bayern bibbert man schon einen Tag früher, nämlich am Namenstag des Hl. Mamertus. Dieser war um das Jahr 450 n. Chr. Bischof von Vienne (Frankreich). Mamertus starb um 477 n. Chr. und wurde wegen wundersamer Heilungen, die sich an seinem Grab ereignet haben sollen, schon bald als Heiliger verehrt.
Am 12. Mai folgt Pankratius (Pankraz). Der historische Pankratius wurde um 290 n. Chr. in Kleinasien geboren und wanderte mit seinem Onkel schon bald nach Rom aus. Als bekennender Christ wurde er gefoltert und enthauptet. Bald danach wurde er heiliggesprochen.
Am 13. Mai feiert man den Namenstag von Servatius (Servaz). Er war Bischof von Tongern (Belgien). Im Mittelalter gab es einen großen Kult um Servatius. Sein Grab wurde zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorten des Mittelalters. Im Jahr 1496 n. Chr. sollen über 100.000 Pilger am Servatiusfest teilgenommen haben.
Der Gedenktag von Bonifatius von Tarsus (Türkei) wird am 14. Mai begangen. Der Legende nach folterte man ihn um das Jahr 300 n. Chr. mit siedendem Pech und heißen Blei. Schließlich wurde er enthauptet. Für sein Bekenntnis zum Christentum und das damit verbundene Martyrium sprach ihn die katholische Kirche heilig.
Am 15. Mai beendet der Namenstag der heiligen Sophie die „Eisheiligen“. Auch sie bezeugte ihren christlichen Glauben offen und wurde dafür mit dem Märtyrertod bestraft. Man geht davon aus, dass sie um das Jahr 300 n. Chr. in Rom gelebt hat.
Bauernregeln (Auswahl)
- Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun‘ und Fass
- Mamerz hat ein kaltes Herz
- Wenn es an Pankratius gefriert wird viel im Garten ruiniert
- Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die Kalte Sophie
- Vor Bonifaz kein Sommer – nach der Sophie kein Frost
- War vor Servatius kein warmes Wetter, wird ist nun von Tag zu Tag netter
- Die kalte Sophie macht alles hie


 Jobbörse
Jobbörse  Events
Events  Mediathek
Mediathek 
 Suche
Suche  Meine News
Meine News 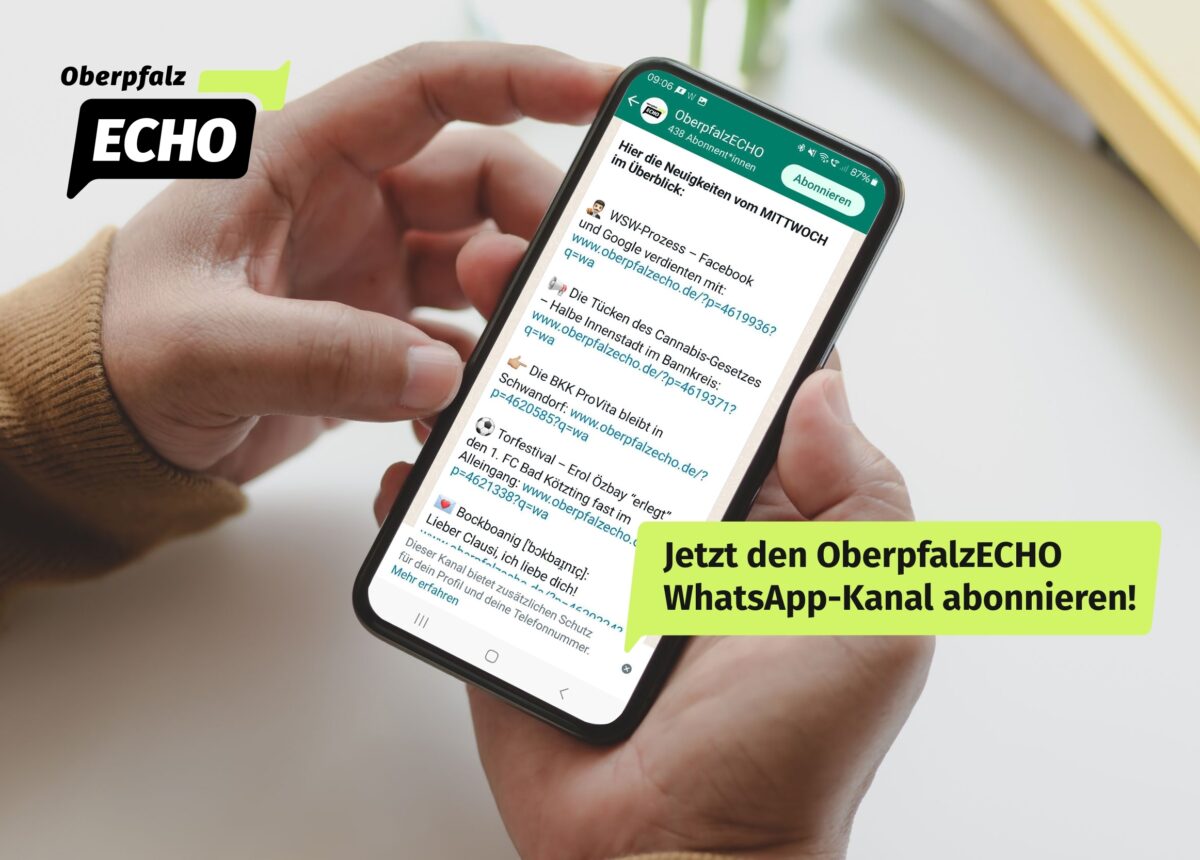



* Diese Felder sind erforderlich.