Wasserstoffzukunft: Regionen fordern mehr Unterstützung
Neustadt. Der BdWR setzt sich für den Ausbau der regionalen Wasserstoffwirtschaft ein, um Energiewende und Wirtschaftsstandort zu sichern. Herausforderungen wie die geringe Investition in Elektrolysekapazitäten und die beschränkte regionale Verfügbarkeit wurden hervorgehoben.
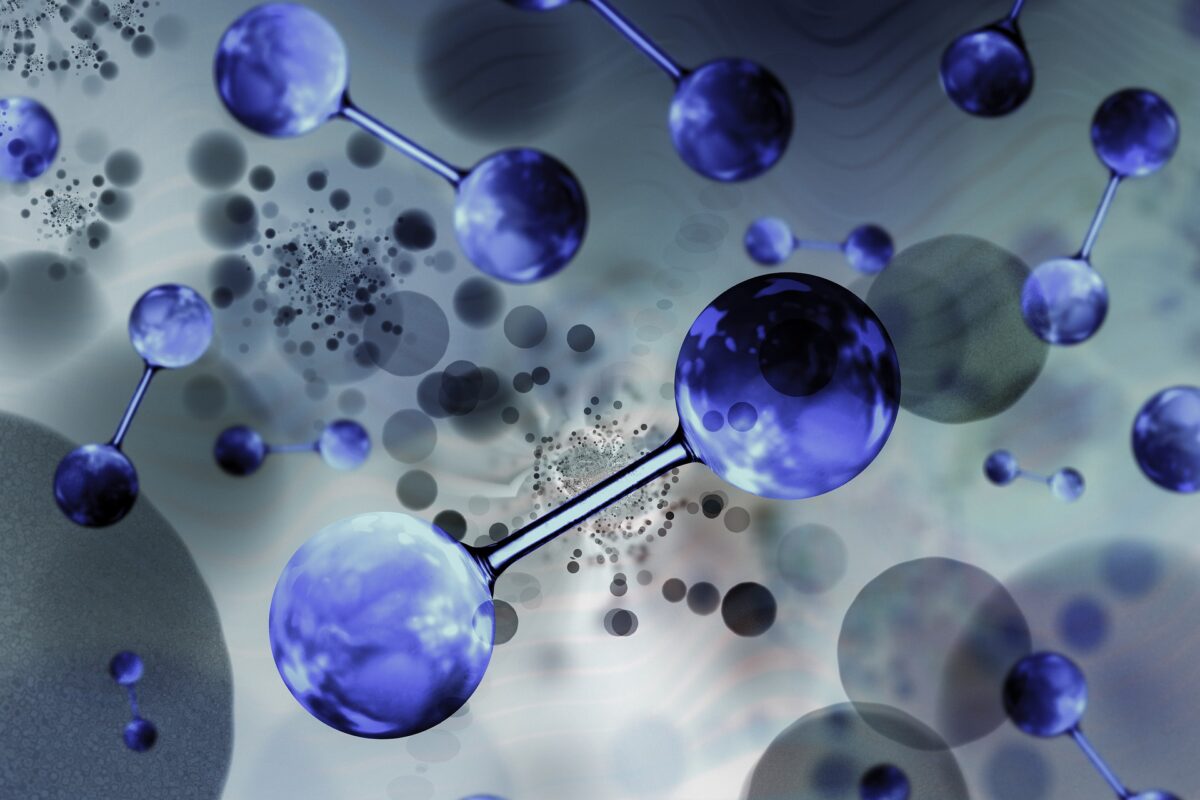
Zukunft der regionalen Wasserstoffwirtschaft
Die Mitglieder des Bundes der Wasserstoffregionen (BdWR) setzen sich aktiv für den Ausbau der regionalen Wasserstoffwirtschaft ein, denn auch die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) benötigen Wasserstoff. Wenn dies nicht geschieht, wird sowohl die Energiewende als auch unser Wirtschaftsstandort gefährdet. Mit Freude und voller Überzeugung hat daher auch Landrat Andreas Meier für den Landkreis Neustadt und damit für die Wasserstoffregion Nordoberpfalz (H2NOPF) das aktuelle Positionspapier des BdWR mitunterzeichnet, denn das gemeinsame Ziel ist es, der Wasserstoffwirtschaft in den Regionen Anschub zu geben und mit einer starken Stimme an die Bundespolitik zu adressieren.
Kompetenzplattform für regionale Akteure
Der Bund der Wasserstoffregionen (BdWR) ist eine Kompetenzplattform für die regionalpolitischen Akteure der deutschen Wasserstoffregionen. Es kommen Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte von aktuell über 30 Wasserstoffregionen zusammen, außerdem der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), um aus den Erfahrungen regionaler Wasserstoffkonzepte zu lernen und konkrete politische Ableitungen zu treffen. Zudem sind kommunale Spitzenverbände als Unterstützer an Bord.
Herausforderungen und Perspektiven
Mit der Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie, mit der Genehmigung des Wasserstoffkernnetzes und auch mit verschiedenen Förderprogrammen wie den Klimaschutzverträgen wurden in den vergangenen Jahren bereits wichtige Weichen für den Wasserstoffhochlauf gestellt. Es bleiben jedoch zahlreiche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die regionale Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft:
Bis 2030 sind in Deutschland ca. 21 GW Elektrolyseleistung geplant, und damit mehr als doppelt so viel wie in der Nationalen Wasserstoffstrategie festgelegt. Jedoch wurde bisher nur für 0,63 GW eine finale Investitionsentscheidung getroffen.
- Die geplanten Wasserstoffprojekte sind hauptsächlich für den Eigenverbrauch von Großindustrien vorgesehen, was die regionale Verfügbarkeit einschränkt.
- Das genehmigte Wasserstoffkernnetz berücksichtigt ebenfalls vorrangig große Industriezentren, Speicher, Kraftwerke und Importkorridore. Große Teile Deutschlands sind damit weiterhin „kernnetzfern“ und absehbar ohne Teilhabe am Aufwuchs der Wassersstoffwirtschaft.
- Ein nationales Wasserstoffnetz auf Verteilnetzebene, das auch regionale Akteure einbezieht, ist erst langfristig zu erwarten.
- Es fehlen verbindliche Abnahme- und Lieferzusagen sowie eine integrierte Bedarfsanalyse und ein strukturierter Planungsprozess.
Bedrohte regionale Wertschöpfungsketten
Regionale Wertschöpfungsketten geraten für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffwirtschaft zunehmend aus dem politischen Fokus. Kleine und mittlere Unternehmen, Stadt- und Gemeindewerke sowie regionale Verkehrsbetriebe drohen dadurch bei der grünen Transformation abgehängt zu werden. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen mit Prozesswärmebedarfen, die nicht über Elektrifizierung dekarbonisiert werden können.
Gemeinsame Anstrengungen sind gefragt
Aus diesem Grund haben sich die Akteure der Wasserstoffregion Nordoberpfalz (H2NOPF) auch an die Bundestagsabgeordneten der Region gewandt, um in einem gemeinsamen Termin die Relevanz regionaler Wasserstoff-Wertschöpfungsketten für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nationalen Energie- und Klimaziele zu erklären, zu diskutieren sowie Vorschlag vorzustellen, wie parallel zum Aufbau des überregionalen Wasserstoffkernnetzes der notwendige Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft ermöglicht werden kann.


 Jobbörse
Jobbörse  Events
Events  Mediathek
Mediathek 
 Suche
Suche  Meine News
Meine News 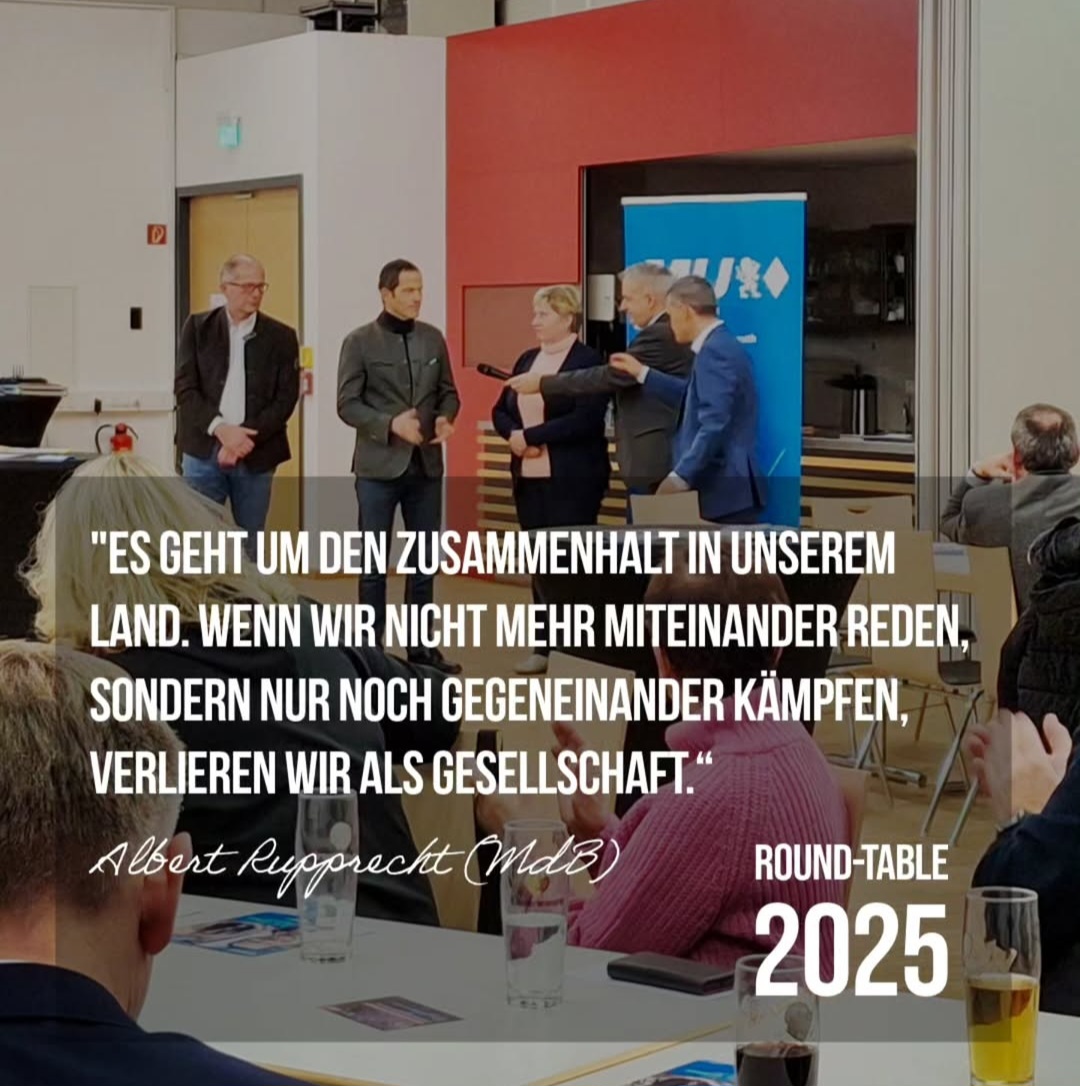



* Diese Felder sind erforderlich.