Am Beispiel Neustadt/WN: Wirtshaustradition, was ist aus dir geworden?
Neustadt/WN. Die Kreisstadt war mal Europas Bleikristallzentrum. Und die vielen Glasmacher hatten auch einen sauberen "Durscht". Darum gab es jede Menge Wirtshäuser. Beides ist schon Geschichte. Eine Spurensuche...

„Zur Krone“, „Zum Bären“, „Zum Wieselbrunnen“, „Zum Kronprinzen“, „Zur Linde“, „Zum Scherm“, „Zur Goldenen Sonne“, „Deutsche Eiche“ und wie sie alle hießen. Das überschaubare Neustadt/WN hatte in der Vergangenheit gastronomisch einiges zu bieten. Kein Wunder: Im einstigen Bleikristallzentrum Europas arbeiteten viele durstige Glasmacher. Übriggeblieben von all diesen Traditionshäusern ist nur mehr das „Weiße Rößl“. Seit 120 Jahren werden hier die Gäste schon bewirtet.
Tausende von „Gloserer“ schwitzten
Bis zu 4000 „Gloserer“ verdienten hier und im benachbarten Altenstadt/WN einst ihre Brötchen. Ein anstrengender, schweißtreibender Job. Heute kaum mehr vorstellbar: damals durfte während der Arbeitszeit der Flüssigkeitsverlust mit frischem Gerstensaft ausgeglichen werden. Danach prostete man sich in den umliegenden Wirtshäusern weiter zu. So mancher glasblasende Ehegatte kam zwar gut abgefüllt, aber mit stark geplünderter Lohntüte daheim, bei Frau und Kindern an.
Eine Mär? Durchaus nicht. Auch Stadtarchivarin Ursula Wiechert weiß aus Erzählungen, dass die damals noch bar ausbezahlten sauer verdienten Kröten nicht selten gegen flüssige Währung eingetauscht wurden.
Chronik über die Stadt Neustadt
Heinrich Ascherl, früherer Sparkassenchef in der Kreisstadt, hatte sich vor gut 40 Jahre hingesetzt und die Geschichte des Ortes aufgeschrieben. In dem 850-seitigen, 1,8 Kilogramm schweren Werk hat er auch der Neustädter Gastroszene ein Kapitel gewidmet. Interessant: es gab Wirtshäuser, die quasi einen regelrechten Versorgungsauftrag für die Glasmacher hatten. Das Gasthaus „Zur Glashütte“ zum Beispiel sollte sich um das Wohl der Beschäftigten der Bauer- und der Hermannhütte kümmern.
Wirtshaus für die Frankhütte
Als sich die Firma X.F. Nachtmann in dem Städtchen niederließ und die Frankhütte eröffnete, musste auch für deren Belegschaft eine neue gastronomische Heimat geschaffen werden. Und so wurde, passenderweise quasi direkt über dem Werkstor, 1901 die Restauration „St. Felix“ aufgemacht. Als Ascherl sich hinsetzte und die Neustadt-Chronik in den Jahren 1980 und 1981 verfasste, gab es noch immer 25 Gastbetriebe, die sich um das leibliche Wohl der Einwohner – und natürlich auch der Gäste – kümmerten.
Wirtshäuser sind verschwunden
Heute hält man, bis aufs „Weiße Rößl“, vergebens nach den alteingesessenen Wirtshäusern Ausschau. Wo einst der Kronprinz stand, haben die Vereinigte Sparkassen ihre Hauptstelle hochgezogen. Der Scherm wich einem Parkdeck. Auch die „Deutsche Eiche“ wurde abgerissen und machte Platz für ein Mietshaus. Das Krone-Gebäude wird als Unterkunft für Asylsuchende genutzt, wo einst die „Goldene Sonne“ schien, arbeiten heute die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Und im „Bären“, mit seinem legendären Tanzsaal, wird heute italienische Küche serviert.
Verband ist in großer Sorge
Das Wirtshaussterben beobachtet man beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband schon seit einigen Jahren mit großer Sorge. Alleine von 2019 bis 2021 gingen mehr als 7000 Kneipentüren für immer zu. Und danach kam auch noch Corona. Hohe Energiepreise, gestiegene Personalkosten und explodierende Kosten beim Wareneinsatz, machen es den Wirten immer schwerer, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten.
„Die Branche kommt am Zahnfleisch daher“, macht Pressesprecher Frank-Ulrich John deutlich. Er weiß aktuell von einem angesagten Drei-Sterne-Landgasthaus – und davon gibt es in Bayern nicht allzu viele – das schließen wird. „Der Besitzer kann und mag nicht mehr.“
Schlag von der Politik
Ein Beispiel: „Ein gastronomischer Betrieb braucht sechsmal mehr Mitarbeiter als ein Einzelhändler“, erläutert der Pressesprecher. Alleine die Personalkosten sind in den vergangenen Jahren um 27 Prozent gestiegen. Und mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer zum Jahreswechsel auf 19 Prozent haben die Gastronomen von der Politik einen weiteren schweren Schlag versetzt bekommen.
Die Branche hat Angst, dadurch noch mehr Gäste zu verlieren. John wird deutlich. „Mit dieser Entscheidung hat die Politik einen Strukturwandel eingeläutet.“ Vom gutbürgerlichen Speiselokal hin zu einer Imbiss- und Fast-Food-Kultur, wie man sie in den USA kennt.
Gastrobranche hat Gewicht
Dabei hat die Gastrobranche im Freistaat mit ihren 477.000 Erwerbstätigen durchaus ein wirtschaftliches und arbeitsmarktpolitisches Gewicht. 10.000 junge Leute absolvieren hier ihre Ausbildung. Aber nicht nur das: Gerade etwa dem klassischen Dorfwirtshaus kommt eine besondere soziokulturelle Bedeutung zu. Hier isst und trinkt man nicht nur, hier trifft man sich, ratscht, oder spielt Karten.
Und auch in puncto Nachhaltigkeit hat das Gasthaus die Nase vorne. „Die Lebensmittel, die hier verarbeitet werden, werden nicht von weit her herangekarrt, sondern stammen größtenteils aus der Region“, betont John. Doch der Verband gibt sich nicht geschlagen und appelliert an die Gäste, gerade ihrem Wirtshaus um die Ecke weiter die Treue zu halten.
Neustädter Wirtshausanekdoten:
So manche lustige und kuriose Begebenheit hat sich in den Wirtshäusern des Städtchens zugetragen, an denen sich so mancher alteingesessene Neustädter heute noch erinnern kann.
Das Alisi-Seidl
Aloys Näger war ein recht geselliger Mensch und ein reger Wirtshausgänger. Er achtete immer genau darauf, dass sein Glas randvoll und wohlgemerkt ohne Schaum eingeschenkt war. War das nicht der Fall, ließ er das Bier wieder zurückgehen. Die Wirte wussten um diese Eigenheit und so war das „Alisi-Seidl“ geboren.
Sauber getankt
Sauber getankt hatte einmal ein Gast im Café Deubzer. Als er im Lokal nichts mehr zu trinken bekam, nahm er noch eine Flasche Bier mit. Die steckte er sich in die Gesäßtasche. Auf dem Nachhauseweg fiel er hin, die Flasche zerbrach. Daheim dann betrachtete er sein zerschnittenes Hinterteil im Spiegel. Am nächsten Morgen schimpfte sein Vater wie ein Rohrspatz. Der Spiegel war voll Blut und mit Heftpflaster zugeklebt.
Neustadt hat auch eine lange Zoigltradition. Ferdinand Kamm hat sie vor gut 20 Jahren in seinem Büchlein „Der Neustädter Zoigl“ aufgeschrieben. Natürlich hat sich auch in den Zoiglstuben so manche lustige und kuriose Begebenheit zugetragen. Zwei Kostproben:
Die Blinzelsulz
Zum Zoigl gab es natürlich auch gute Brotzeiten. Das Problem: Es gab damals keine Kühlhäuser. Die Speisen mussten ebenso wie das Bier in tiefen Felsenkellern gelagert werden. Die waren meist mit einem fest gestampften Lehmboden versehen. In so einen Keller hatte der Wirt die frische, noch flüssige Sulz gestellt, damit sie fest wird.
Als nun der Gast die Sulz auf dem Tisch hatte, stutzte er und meinte zum Wirt: „Du, die Sulz blinzelt ja!“ Und in der Tat, in der Sulz bewegte sich etwas. Ein kleiner Frosch war hineingehüpft. Und als die Sulz fest wurde, kam er nicht mehr raus. Nur noch die Augen konnte das Viecherl bewegen – die „Blinzelsulz“ war geboren.
„Oh Tannenbaum!“
Der Flaschner-Röis war beim „Stoodmüller“ Stammgast. Der Röis hatte einen roten Stiftenkopf. In der Vorweihnachtszeit kam einer der Gäste auf die Schnapsidee, Zündhölzer anzuspitzen und sie dem Flaschner-Röis in den Kopf zu pieksen. Den störte das nicht weiter. Dann wurde in der Zoiglstube das Licht ausgemacht, die Zündhölzer auf dem Kopf vom Röis angezündet und das Lied „Oh Tannenbaum“ angestimmt. Als es dem Röis zu heiß auf seiner „Plattn“ wurde, wischte er sich die Streichhölzer kurzerhand wieder vom Kopf – und weiter ging die Zecherei.


 Jobbörse
Jobbörse  Events
Events  Mediathek
Mediathek 
 Suche
Suche  Meine News
Meine News 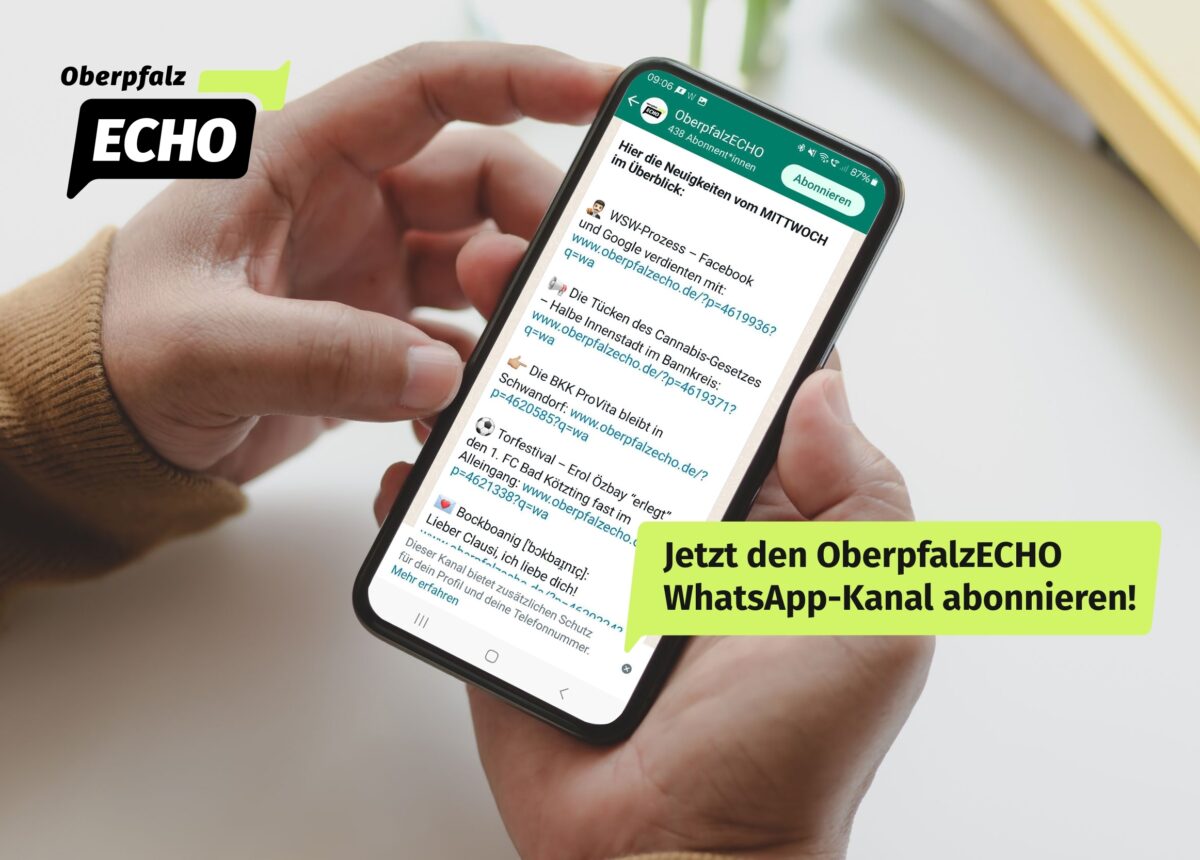



* Diese Felder sind erforderlich.